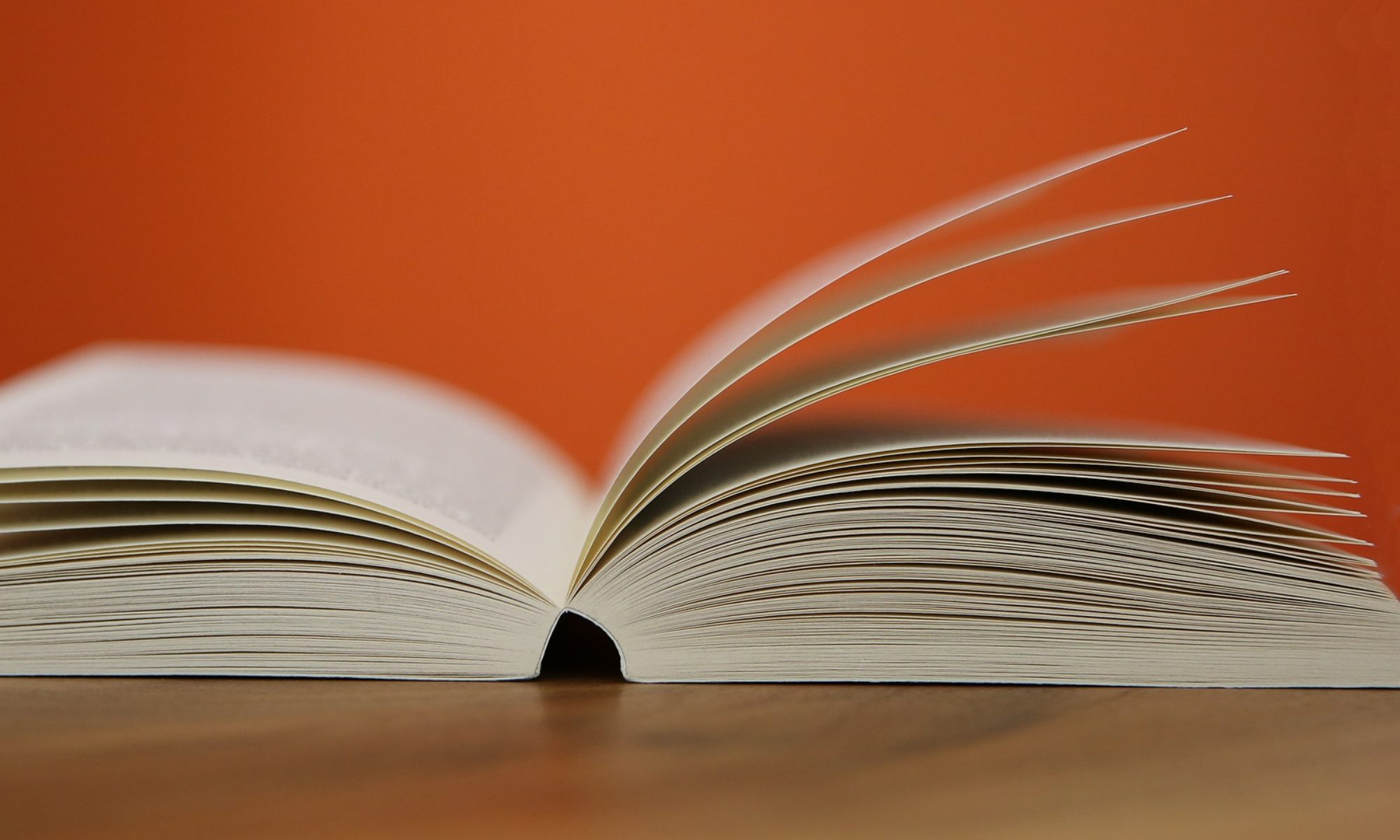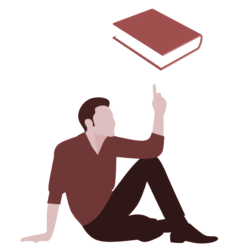Stephan Thome: Gott der Barbaren – Roman, Suhrkamp, 2018.
Ein historischer „Abenteuerroman“ im China zur Mitte des 19. Jahrhunderts und nominiert für den deutschen Buchpreis: Das ist genau mein Ding, dachte ich. Um es vorweg zu nehmen, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, aber eben auch nicht erfüllt. Es ist ein merkwürdiges Buch, vermutlich weil es historischer Roman, philosophisches Gleichnis und poetisches Gemälde zugleich sein möchte. Aber „abenteuerlich“, wie es der Verlag anpreist, ist es doch kaum jemals und die wenigen Passagen, da die Erzählweise wirklich in diese Richtung geht, sind dann doch stark ästhetisiert, so dass eigentlich der Nervenkitzel ausbleibt, die starken Schilderungen jedoch ihren bleibenden Eindruck machen. Selbstverständlich ist insbesondere der Weg der Hauptfigur ins unbekannte China ein grosses Wagnis, da die Handlung so sehr in den Köpfen und in Monologen stattfindet, ist man eher fasziniert anstatt gefesselt. Erstes Zwischenfazit: Kein Abenteuerroman! Dann zeigt sich anhand des dichten Innenlebens der Charaktere viel, manchmal all zuviel menschliches Denkverhalten. Nicht wenig wird auf Hegel verwiesen und zum europäischen Weltbild lässt sich wohl kaum ein antithetischeres als das fernöstliche hernehmen, von daher ist die Referenz sehr passend gewählt, zumal sich hegelianische Konzepte wohl nur anhand des konkret geschilderten Beispiels in erträglicher Weise aufzeigen lassen. Als Kontrast und zur Ebenbürtigkeit des interkulturellen Dialogs, den der Roman pflegt, werden verschiedene chinesische Weisheiten und Sinnsprüche miteingewoben und stark gemacht. Die westlichen „Teufel“ erscheinen so angesichts der jahrtausendealten chinesischen Kultur nicht selten als unbeholfene und starrköpfige Trottel, die Asiaten hingegen als verschlossen und unbeteiligt grausam, so dass die immer wieder geäusserte Ansicht, dass die Chinesen erhaben und im Gegensatz zu allen anderen die eigentlichen Menschen seien, weil sie Mitgefühl hätten, nicht nur widersprüchlich, sondern geradezu verstörend wirkt. Dass Fremd- und Selbstbilder nicht nur verklären, sondern geradezu irreführend sind, zeigen diese rund siebenhundert Seiten eindrücklich auf und geben Anlass, die eigenen Vorstellungen des Menschseins zu hinterfragen. Dennoch beeindruckt das Buch vor allem als Ode an die Gelehrsamkeit, weniger als Anregung zum persönlichen Umdenken und wirkt damit eher schmälernd auf das intellektuelle Selbstbewusstsein der Lesenden. Zweites Zwischenfazit: Als philosophisches Gleichnis nur ansatzweise inspirierend! Dann aber werden die Personen derart gut gezeichnet mit Kontrasten und Kanten, man taucht ein in ihre Vorstellungswelt und wird Zeuge ihrer Gedanken, ebenso bleiben die Schilderungen von Ereignissen und Orten wie persönliche Erinnerungen haften, dass man rein literarisch allemal auf seine Rechnung kommt, wenn man sich dem gemächlichen Tempo des Erzählens anvertraut. Man hat Gelegenheit, sich im Wuwei des Lesens zu üben, also zu Lesen, ohne dabei etwas zu erwarten, rein um des Lesens willen. Dann ist auch das wenig ergiebige Ende des Buches nicht eine Enttäuschung, sondern eine Einladung, die Geschichte in Gedanken weiterfliessen zu lassen. Echtes Fazit: Auch wenn man zum Schluss nicht viel mehr über diese geschichtlich interessante Zeit weiss, auch wenn man wenig gedankliche Beute machen kann, auch wenn man zum Schluss gar nicht so recht weiss, was man da nun gelesen hat, bleibt eine gefühlte Bereicherung zurück, die der Weite des allgemeinen Horizonts zuträglich ist. Am Schluss eines Romans sollte doch ein Gefühl bleiben, das gelingt „Gott der Barbaren“ auf jeden Fall, nur ist das Gefühl eher komplex und damit wohl ein passendes Abbild des Themas. Die Wirkung bei mir war jedenfalls die, dass sich die Zeitempfindung ausgedehnt hat, dass sich die Empfänglichkeit für das Harmonische gesteigert hat und dass ich gerade im Moment meine wiederentdeckte Liebe zum Grüntee pflege…