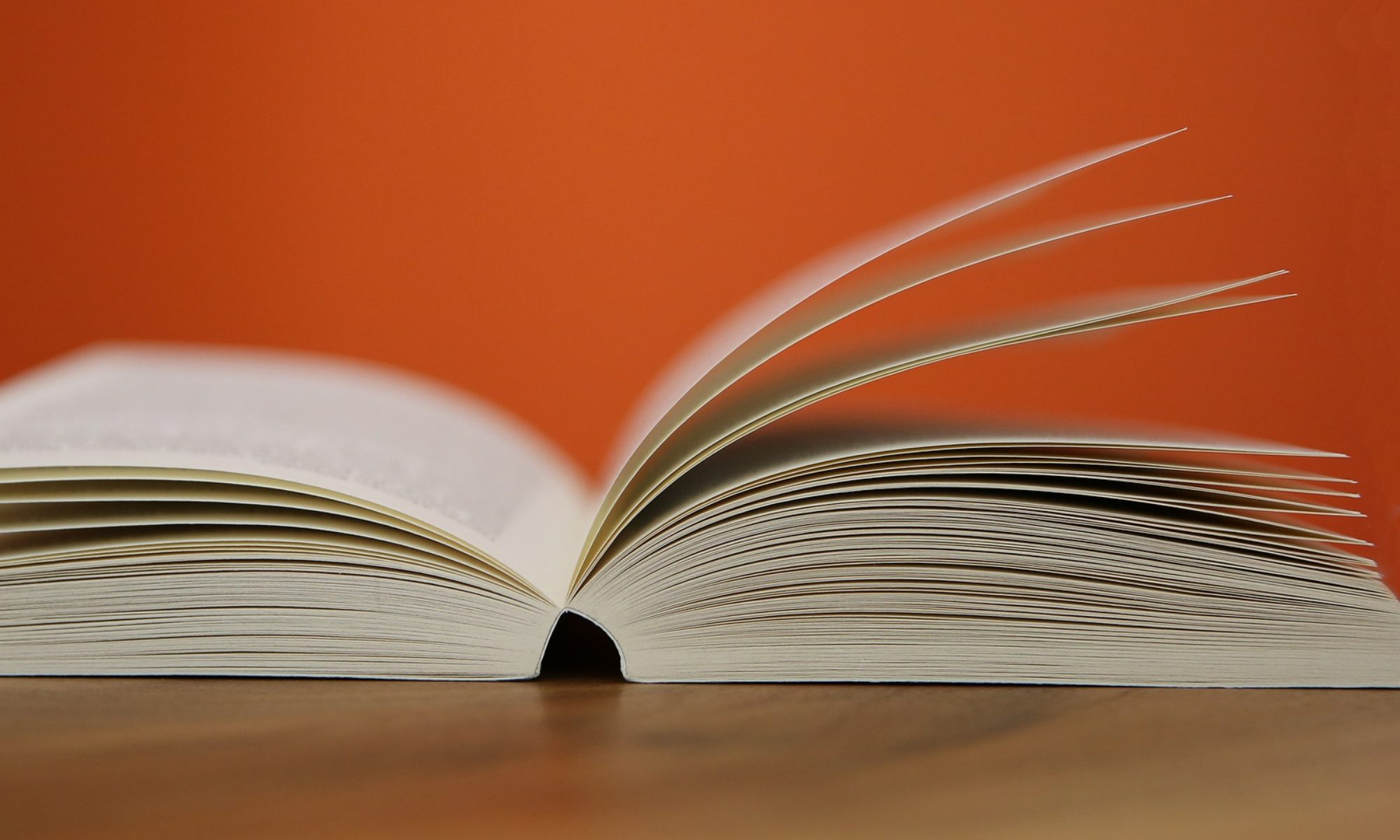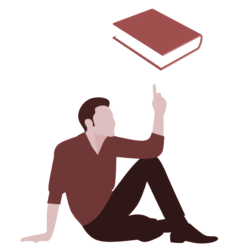Hanser 2009 + Penguin 2012

Um das zwanzigste Jahrhundert und indirekt auch die Umbrüche der heutigen Lebenswelt besser zu verstehen, empfiehlt es sich, die Welt um 1900 genauer kennen zu lernen. Eine lesenswerte Gelegenheit hierzu bieten die beiden Bücher von Blom und Clark, wobei ersteres eher der Frage nachgeht, wie die Zivilgesellschaft im heutigen Sinne entstanden und eine ganz andere Welterfahrung innert weniger Jahre verschwunden ist und letzteres aufzeigt, wie der kriegerische Konflikt des ersten Weltkriegs angesichts der Machtblöcke, Defensivpakte, Schuldverhältnisse und der schier unüberwindlichen Denkmuster praktisch unvermeidbar war.
„Die Schlafwandler“ ist insofern unüblich, als es auch die psychologischen Vorgänge und gesellschaftlichen Werte thematisiert, die angesichts der rapiden Veränderungen und Beschleunigungen vor allem im Gebiet der Technik nur mit einem Wort zu beschreiben wären: individuelle und kollektive Überforderung. Auf diesen Umstand reagierten die meisten Individuen und Gesellschaften gleichsam mit reaktionären Fluchten in Stereotype, vor allem jene der Männlichkeit, der Kontrolle und der Nation. Schon allein diese Übersteigerungen machten einen friedlichen Weg ins beginnende zwanzigste Jahrhundert schwierig oder gar unmöglich.
Auch in „Der taumelnde Kontinent“ zeigt sich, dass die konstanten und immer zahlreicheren Infragestellungen durch technologische, kulturelle wie auch soziale Umbrüche beinahe alle herkömmlichen Garantien in Frage stellten oder gar obsolet erscheinen liessen. Status, Autorität, Hautfarbe, Geschlecht, Vernunft und Bildung waren in den Jahren um die Jahrhundertwende zu Quellen der Verunsicherung geworden. Blom zeigt auf, wie vornehmlich die ängstlichen, weissen Männer sich in Obsessionen der vermeintlichen Stärke und Überlegenheit stürzten. Mit dem aufkeimenden Selbstbewusstsein der Frauen, kam jenes der Männer ins Wanken, worauf diese ihre gesellschaftliche Stellung verteidigten und durch Militarismus, Kolonialismus, Sexismus und zahlreiche weitere hässliche Ausgestaltungen des Herrschaftsgefüges noch ausbauten.
Während sich die einen durch den Rückgriff auf ein verklärt viriles und offen rassistisches Welt- und Menschenbild gegen die Modernisierung aller Lebensbereiche stellten, konnten die anderen, etwas feinfühligeren Naturen, sich oft selbst nicht mehr retten und drifteten angesichts der zahllosen Eindrücke, Neuerungen und Mechanisierungen von Arbeit in ein Gefühl der Nutz- und Hoffnungslosigkeit, nicht selten entwickelten sie bislang unbekannte Nervenleiden. Sprache und Denken waren noch ausgerichtet auf ein überschaubares Leben in einem gemächlichen Tempo innerhalb von einigermassen konstanten gesellschaftlichen Strukturen. Binnen zweier Jahrzehnte hatte sich die Lebenswelt komplett gewandelt und bewirkte bei den Menschen Verblüffung, Spannung, Unsicherheit, Wut und oft auch Grausamkeit.
Beide Bücher entführen in eine Zeit, die unserer so unglaublich fremd erscheint, wenn man das Nachwirken und die Verwurzelungen des neunzehnten Jahrhunderts erkennt. Zugleich jedoch befinden wir uns heute an einem sehr ähnlichen Punkt, vieles wird durch die Digitalisierung obsolet ähnlich wie damals durch die Mechanisierung. Menschen sind gezwungen, über ihren Wert als Arbeitskraft oder Person und über ihre Wertvorstellungen grundlegend nachzudenken. Lernen könnte man aus dieser Parallellektüre, dass man auch zugeben darf, wenn etwas verunsichert oder gar Angst macht, anstatt sich durch Aktivismus oder Reaktionismus nur weiter zu überfordern. Damit vielleicht nicht wie damals Massen von Neurasthenikern (Burnout-Patienten), systematische Unterdrückungen oder Ausbeutungen und bestialische Gewaltexzesse die Folge der globalen Umformungen sind, sondern ein trotz aller Konflikte und Komplexitäten auf Verständnis und Sorgfalt beruhendes Füreinander von Menschen, Natur und Technik, welches im Idealfall allen drei zugute kommt.