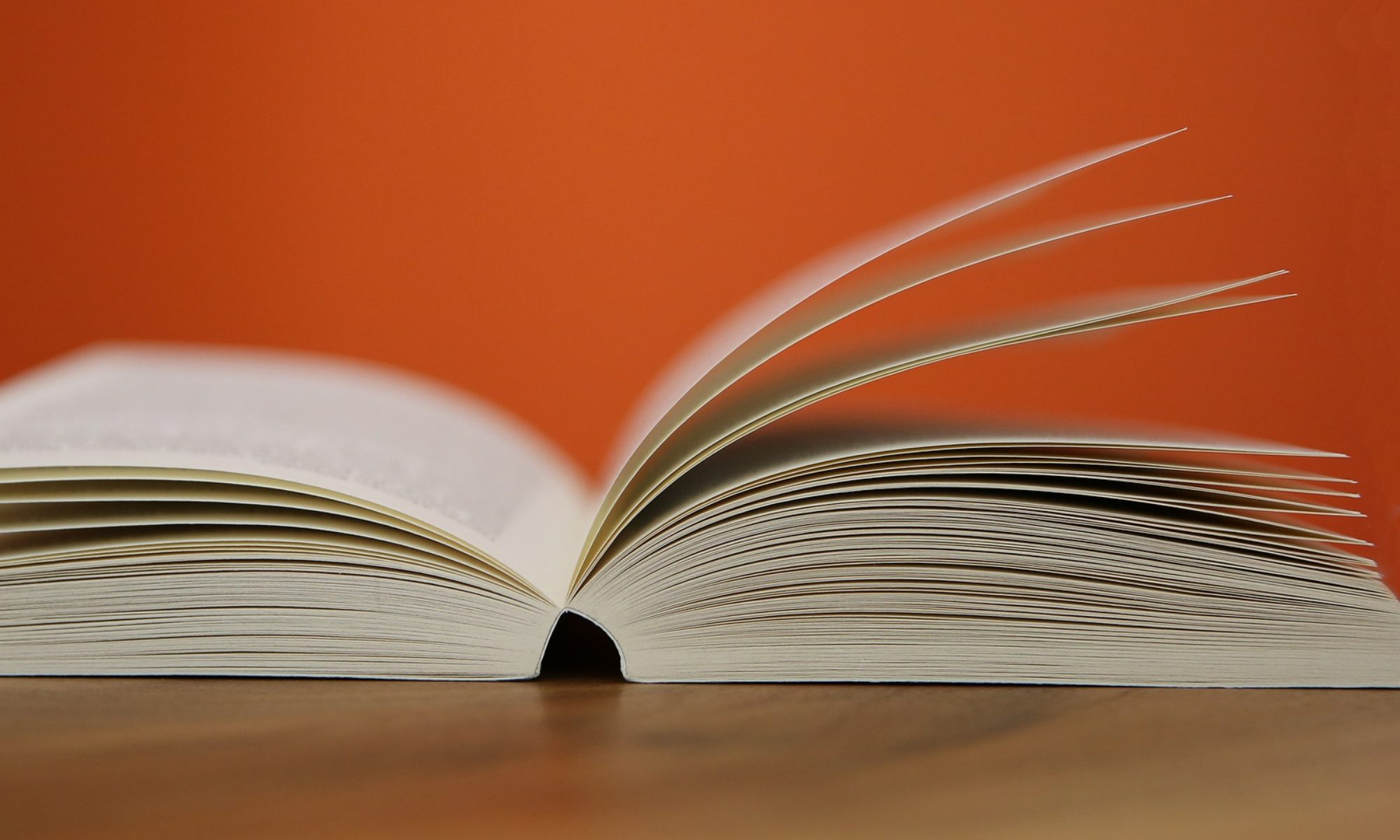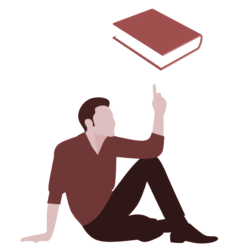Hanser 2014 + Penguin 2016 + 2019

Fragt man sich, worin das lebensweltliche und das geistige Erbe der Zerwürfnisse und Entwicklungen des letzten Jahrhunderts liegt, drängt sich auf, dass aus den zahlreichen, oft komplett verantwortungslos, nicht selten mutwillig und vereinzelt desaströs herbeigeführten Trümmerhaufen althergebrachter Strukturen und Vernunftprinzipien, zwar eine befreiend anmutende, neuartige Komplexität und Vielgestaltigkeit (das bunte Graffitto im Bild oben) entstanden ist, zugleich aber auch eine unglaublich dilettantische wie kurzsichtige Dekonstruktion oder Umwandlung von Sicherheiten und Richtlinien einherging, die heute in eine lähmende Unverfügbarkeit von damals angestossenen Entwicklungen mündet.
Aus heutiger Distanz gesehen, erscheinen diese Handlungen ihrer Tragweite und Schwere nach kaum mehr nachvollziehbar, da man sich mit den ambivalenten Konsequenzen der damaligen Handlungen konfrontiert sieht und diese höchstens noch abmildern, aber nicht mehr rückgängig machen kann, was z.B. im Fall von Gleichberechtigung ja gar nicht wünschenswert wäre. Die Perspektive früherer Menschen ist natürlich immer eine andere als jene ihrer Nachkommenschaft, jedoch ist das zwanzigste Jahrhundert insofern besonders, als dass seine unsäglich barbarischen Umbrüche ebenso wie die unglaublich fortschrittlichen Durchbrüche, die es mit sich brachte, das Konzept und den Sinn der menschlichen Ziviliation selbst fundamental in Frage stellte.
Die drei Bücher von Blom und Kershaw können helfen, diese Sichtweisen, vor allem aber die Empfindungen von Menschen vor dem Ende des Jahrtausends angesichts der vormals völlig ungeahnten Potentiale von Entfaltung und Zerstörung zu rekonstruieren. Während Blom wie so oft durch eine kulturwissenschaftliche Lupe auf das Leben der Zwischenkriegszeit das Warum des zweiten Weltkriegs und der von ihm geschlagenen Wellen etwas nachvollziehbarer macht, ergibt sich durch die nüchterne und niemals einseitige Betrachtung Kershaws ein Überblick auf zehn Jahrzehnte Menschheitsgeschichte, die dadurch zwar nicht nachvollziehbarer, aber in ihrer Bedeutsamkeit durchaus um einiges klarer werden.
Die starken Kontraste, die sich primär gesellschaftlich ab 1900 und noch intensiviert nach 1918 bemerkbar machten, brachten tiefgreifende Veränderungen auf allen Ebenen des menschlichen Daseins ins Rollen, die zuvor undenkbar gewesen wären. Die beiden Weltkriege waren in vielerlei Hinsicht nicht nur grosse Gleichmacher, sonden schufen neue Arten der Ungleichheit, die in Verbindung mit dem ungebrochenen technologischen Machbarkeitsglauben und durch existentielle Ängste vor dem Kontrollverlust eine unheilvolle Wirkung zeitigten. Alles wurde dem Cliché-Europäer zur Bedrohung: Frauen, Talent, Intelligenz, Hautfarbe und überhaupt alles Andersartige. Unfähig, diese Herausforderungen als Bereicherung zu sehen und sich ihnen zu öffnen, blieb den vom alten Bild der männlichen Rationalität geprägten und zugleich von Kriegserlebnissen traumatisierten Gesellschaft nichts anderes als reaktionäre Flucht in die vertrauten Mittel und deren Steigerung in die Perversion: Aneignung, Abschreckung und Unterdrückung.
Die mit diesem Verhalten einhergehenden Privilegien schienen viele, wenn nicht sogar alle Massnahmen zu rechtfertigen. Zunächst wenigstens; doch mit fortschreitender Eskalation dieser narzisstischen Machbarkeitsideologie und ihren immer hässlicher werdenden Niederschlägen in Form von Diskriminierung, militärischer Aufrüstung, radioaktiver Verstrahlung, anhaltender Umweltzerstörung und globaler Ausbeutung, regte sich der Widerstand insbesondere in jenen Gesellschaften, die ausgehend von diesen Privilegien immer gebildeter und egalitärer wurden. Kershaw zeigt auf, wie sich diese Umwälzungen auch in diesem Jahrhundert bemerkbar machen und hört mit der Geschichtsschreibung erst in der Gegenwart auf und thematisiert zum Schluss sogar noch den Brexit, was eher unüblich ist für einen Historiker, da man sich doch oft eine reflexive Distanz von rund zwanzig Jahren herausnimmt, um die vergangenen Prozesse im Lichte ihres Kontextes schildern zu können. Seine Entscheidung, einen fliessenden Übergang in die jüngste Zeitgeschichte zu wagen, unterstützt und vertieft genealogisch durchaus das Verständnis der heutigen Begebenheiten.
Alle drei Bücher ergänzen sich zu einem guten Überblick der Dynamik der letzten hundert Jahre. Die damalige Zeit und insbesondere ihre Zeuginnen und Zeugen entrinnen mitsamt ihren Erinnerungen nun langsam dem kollektiven Gewahrsein. Wie mag es sich angefühlt haben? Ohne Geld in der grossen Depression, leicht verrucht im Jazz-Keller, im scheinbar gerechten Krieg mit allen Mitteln, in den Trümmern der alten Welt, im Rausch des Wirtschaftswunders, angesichts der nuklearen Apokalypse, jedes Wort wie ein mögliches Todesurteil abwägen müssen, beflimmert der Mondlandung beiwohnen, für die Rechte der halben Menschheit oder gegen das Waldsterben demonstrieren, auf einmal frei auf der Mauer sitzen oder erstmals begeistert ein Rockkonzert besuchen zu können? Dies sind alles Gefühle, die aus globalisierter Perspektive zwangsläufig immer etwas eingeschränkt wirken mögen, für die Leute damals war die Erfahrung ihrer Lebenswelt jedoch absolut und nicht relativiert wie für uns. Es könnte also nicht schaden, selbst sein Weltbild etwas zu erweitern, die nachfolgenden Menschen ebenfalls im Blick zu haben und sich dieses Mal wahrhaft zu emanzipieren zu einer Spezies, die verantwortlich mit sich selbst und diesem einzigartigen Planeten umgeht.
“War, like death, is a great leveller, and mutual suffering and endurance had made us all friends.”
– Mary Seacole, „Wonderful Adventures of Mrs. Seacole in Many Lands“ (1857)
Weiterführende Links:
Philipp Blom: Die zerrissenen Jahre – Hanser Verlag
Philipp Blom spricht über „Die zerrissenen Jahre. 1918-1938“ – YouTube
Leselounge: Philipp Blom im Gespräch mit Günter Kaindlstorfer – YouTube
Ian Kershaw: To Hell and Back – Penguin