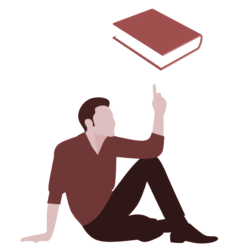Roman, Diogenes, Zürich 2014.
Nein, ich habe den Film noch nicht gesehen, mit Absicht. Zuerst wollte ich das Buch lesen. Und ich vermute, dass das Kopfkino in diesem Fall um Längen besser ist als der Film, aber das wird sich zeigen. Jahrelang hatte ich diesen Roman auf der mentalen „Zu-Lesen-Liste“, er war eben eines jener Bücher, die man auf die lange Bank schiebt mit der Überzeugung, dass sich schon eine Gelegenheit ergeben wird, es zu lesen und ansonsten hätte man auch nicht viel verpasst. Nun, da sich die Gelegenheit mit dem Argument von 1.90 Franken gewissermassen aufgedrängt hat, finde ich, man sollte die rund zweihundertsiebzig Seiten lieber lesen als diese ulkige Geschichte zu verpassen. Von der Handlung möchte ich eigentlich nichts preisgeben, weil sich daraus gerade der gewinnende Reiz von Wolkenbruchs Reise ergibt. Man kann sich aber vorstellen, dass ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren, der noch bei den Eltern und zudem in der etwas beengenden Geborgenheit der jüdischen Gemeinde lebt, der die Fühler ausstreckt in jene auf ihn zunächst befremdlich wirkende „Aussenwelt“, die ihn fremd im eigenen Haus werden lässt, ohne Weiteres die eine oder andere Verwirrung stiften kann. Besonders, wenn seine Mutter und das zur Überdehnung neigende Verhältnis zu ihr derart witzig mit viel Situationskomik ausgemalt und im Sinne der Kunst überzeichnet wird, so dass man bei der Lektüre einfach nicht anders kann als laut herauszulachen. Wenige Seiten dauert es und man hat die Hauptfigur Motti ins Herz geschlossen und kann mit ihr mitfühlen, um sie dann doch wieder zu bekopfschütteln, wenn sie mit einer für die Jugend typischen Tollpatschigkeit durch das Kuriosum zwischen Geburt und Tod stolpert, bisweilen auch torkelt, wenn sie „basojfn“ ist. Der Einblick in die jiddische Sprache und die kulturellen Eigenarten der jüdischen Gemeinschaft eröffnen auch einen ganz anderen Blick auf das heutige Zürich. Mottis Verwandlung zum Käfer der Familie verwandelt Bilder und Befremdlichkeiten mit unbeschwerter Leichtigkeit und Humor in Geschichten und Vertrautheiten. Nur die Begegnung oder „bagegenisch“ von Menschen, sei sie nun gewollt oder (vom Autor) schicksalshaft herbeigeführt, ermöglicht es dem Ich im Sinne Bubers am Du etwas über sich selbst zu lernen – je fremdartiger dabei das Du daherkommt, umso einfacher aber auch unverblümter kann oder muss sich das Ich selbst erkennen. Herr Wolkenbruch kann oft die Fettnäpfchen einfach nicht auslassen und ist daher weniger ein Held als ein Gleichnis für das vertrauensvolle Offensein für das Unbekannte in jeglicher Form: „Es geht auch nicht darum (…) die Zukunft zu sehen, sondern die Gegenwart, die unsichtbaren Teile der Gegenwart, in denen das Künftige angelegt ist.“ Dies zeigt sich eigentlich schon im ersten Satz, der ein kommendes Unheil ankündigt: „Mottele, wo bist du? Ich mache mir sorgn!“ Und schon beginnt’s zu rattern im Kopf…