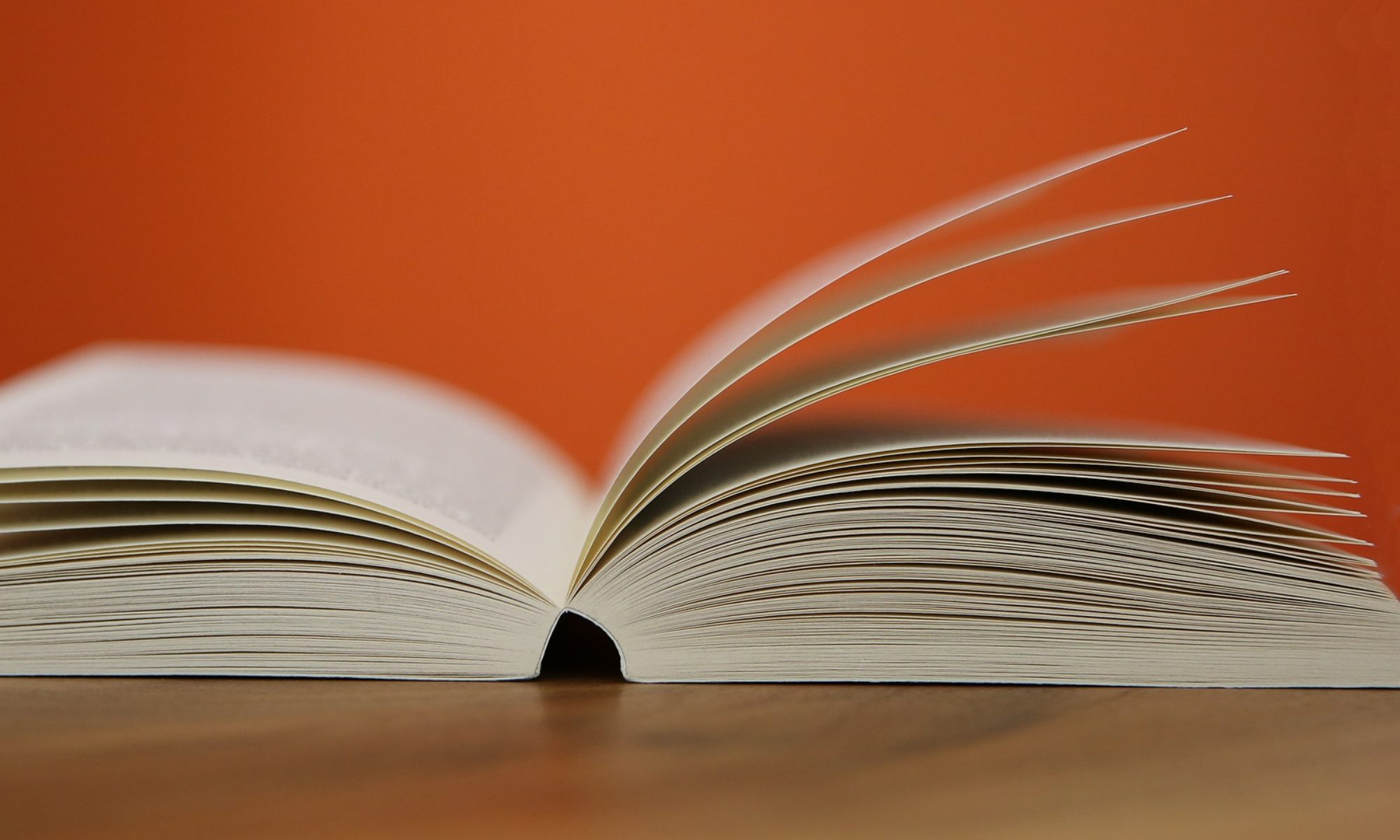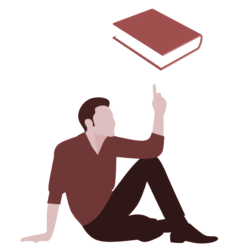Frank Schätzing: Die Tyrannei des Schmetterlings – Roman, Kiepenheuer & Witsch, 2018.
Beinahe durchgehend schlechte Kritiken erhält dieser neue Roman von Schätzing, wenn man jedoch den Schwarm (2004) so verschlungen hat, wie ich damals, kriegt man auch diesen Wälzer locker runter, und zwar ohne schwer schlucken zu müssen. Sowohl die Handlung, weil realistischer, der Stil, weil stimmungsvoller, vor allem aber auch die Spannung sind stellenweise sogar eindeutig besser. Wenn also mitunter bemängelt wird, das Buch ende abrupt und allzu hollywoodianisch, mag man vielleicht vergessen haben, dass der Schwarm zum Schluss diesen Prädikaten ebenfalls genügt und dabei sogar noch etwas abwegiger ist. Doch eins ums andere: Schätzing trifft mit den Themen künstlicher Intelligenz und Silicon-Valley-Kapitalismus durchaus und wieder einmal den Nerv der Zeit; dies war für mich eindeutig ein Grund, das Buch überhaupt in die Hand zu nehmen. Es fällt auch nicht schwer, sich geistig mit den Hauptfiguren zu verbandeln, denn obgleich anderswo das Gegenteil behauptet wird, besitzen diese Charakteren durchaus Tiefe und genügend Ambivalenz, um ausreichend echt zu wirken. Nebenbei angemerkt, will Schätzing ja sein Kino im Kopf literarisch zur Verfügung stellen, was auch eine gewisse Seichtheit erlaubt angesichts der immersiven Bildgewaltigkeit der Schilderungen. Und wenn bei mir ein Buch jenen Moment der filmischen Ergriffenheit auslöst, bei dem man sich buchstäblich mit den Fingern in den Sitz krallt, dann kann ich es gerne gelungene Unterhaltung nennen. Übrigens nehmen manche Rezensionen eindeutig zu viele überraschende Momente vorweg, so dass ich froh bin, zuvor keine gelesen zu haben. Als ethisches Gedankenexperiment, das jedoch stets im Rahmen des Möglichen bleibt, regt die Geschichte wirklich zum Nachdenken an. Bei aller philosophischen Güte und wissenschaftlichen Durchdachtheit, geht aus meiner Sicht die Logik der Entwicklungen des späteren Buches nicht ganz auf, aber niemals so, dass es einen am Weiterlesen und Mitdenken hindert. Im Kontrast dazu liest sich nämlich auch vieles als Parodie auf Personen und Gegebenheiten unserer gegenwärtigen Gesellschaften. Dass das Buch einige Längen aufweise, stimmt nur bedingt, würde ich sagen, denn gerade die gemächliche Erzählweise der ersten Hälfte trägt sehr zur unheimlichen Atmosphäre bei und erlaubt die massive Steigerung des Tempos gegen das Ende hin. Dort hingegen braucht es wirklich keine verdichtenden Beschreibungen und fantasievollen Ausschmückungen mehr, die eben schon auch vorhanden sind. Mir ist das eigentlich kein Dorn im Auge, da ich jeweils dazu tendiere, am Schluss eines guten Buches eher langsamer zu lesen, um es noch ein wenig länger geniessen zu können. Und okay, zugegeben, das Finale ist kitschig, aber eben, das verheisst auch schon die Umschlagsgestaltung und die Erfahrung mit dem Schwarm. Aber insgesamt, so als „Schwarm 2.0“ betrachtet, hat sich für mich die Lektüre mehr als gelohnt. Wenn man zu viel erwartet, wird man enttäuscht, ganz klar. Aber es handelt sich ja um eine bestimmte Art von Science-Fiction, die einen jeden Film übertreffenden Zuwachs an Spannung, Information und Vorstellungskraft bietet, und zwar nicht zu knapp. Genervt an diesem Buch hat mich eigentlich nur, dass es offenbar etwas hastig lektoriert worden ist. Zudem möchte ich behaupten, dass ich auch in hochstehender Literatur nur selten so berührend formulierte Sätze wie diese vorgefunden habe:
„Jemand hat Emmylou Harris mit einem Vierteldollar gefüttert, unterschluchzt von Slide-Gitarren singt sie das Lied einer Sitzengelassenen. Der indianisch aussehende Trucker, der öfter in Downieville übernachtet, wiegt sich mit einer nicht ganz nüchtern wirkenden Frau versonnen in seiner Jugend. Fleischsaft läuft aus dem Brötchen. In der Touristensaison ist das St. Charles Place ein lärmender, ausgelassener Ort, an den Abenden wie diesen durchtränkt von jener schwer zu fassenden Melancholie, die nur versteht, wer in den Lebenden die Toten sieht. Die drei riesigen Spiegel hinter der Bar werfen jeden gefassten Vorsatz, der über die nächste Bestellung hinausgeht, auf ihren Urheber zurück. Man starrt blind auf sich selbst, für den Moment zufrieden. Das kräftige Bier spült den bitteren Geschmack vergeudeter Jahre hinunter, die Ereignislosigkeit des Abends wärmt wie ein falsches Kaminfeuer.“ – Zitiert: Seite 323.
- www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/frank-schaetzing
- www.tagesspiegel.de/kultur/die-tyrannei-des-schmetterlings
- www.sueddeutsche.de/kultur/roman-von-frank-schaetzing
- www.deutschlandfunk.de/frank-schaetzing-die-tyrannei-des-schmetterlings
- www.literaturzeitschrift.de/book-review/schaetzing-schmetterling